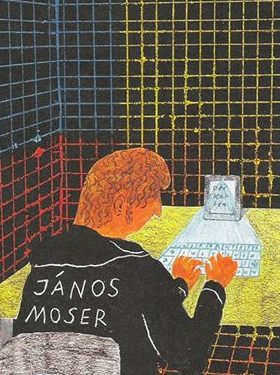Im Dorf B. passierte wenig von Bedeutung. Deshalb kam dem Gemeindepräsidenten Hennig die Tatsache, dass eines Morgens ein Schreiben des Fürsten der Unterwelt auf seinem Pult lag, wie ein Wunder vor. Darin verkündete der Fürst, dem Dorf einen Besuch abstatten zu wollen. Grund dafür sei, dass er alle Winkel seines Reiches zu sehen begehrte. Herr Hennig schwirrten viele Fragen durch den Kopf, deren drängendste war, seit wann B. eigentlich der Unterwelt abgehörte. Er kannte sein Dorf gut, ihm hätte auffallen müssen, wenn etwas Seltsames geschah. Andererseits war vielleicht der Umstand, dass eben nie etwas Aufsehenerregendes passierte, das deutlichste Indiz dafür, unter welcher Herrschaft das Dorf stand. Der Gedanke an die höllische Langweile, die die Bürgerinnen und Bürger erlitten, und die Hennig bislang so geflissentlich übersehen hatte, bereitete ihm Kopfschmerzen. Der Besuch des Fürsten wiederum freute ihn, denn er wäre das erste Grossereignis in der Geschichte des Dorfes. In den kommenden Tagen machte sich Hennig also daran, die baldige Ankunft des Teufels bekannt zu machen. Die Leute von B. reagierten zunächst skeptisch und verwirrt, doch als er die Echtheit des Briefes durch einen Forensiker bestätigen liess – das Wachssiegel bestand immerhin aus Blut – verflüchtigten sich ihre Zweifel. Sie trafen allen nötigen Vorbereitungen, um den Leibhaftigen gebührend zu empfangen: Auf dem Dorfplatz wurden Schädelknochen zu einem gottlosen Bauwerk getürmt; die Wände der Kirche mit lästerlichen Symbolen und Bildern beschmiert; im Fluss landeten die Abfälle der Dorfmetzgerei; der Friedhof verwandelte sich in eine offene Leichenschau; und vor dem Gemeindehaus pfählte man noch schnell einen örtlichen Verbrecher. Nachdem alles eingerichtet war, wartete man Punkt zwölf am Allerheiligentag – denn dann wollte der Fürst erscheinen – sehnlichst auf ihn. Doch die Minuten und Stunden vergingen, und er tauchte nicht auf. Die Bewohnerinnen und Bewohner von B., die sich auf dem Dorfplatz versammelt hatten, wurden grantig. Manche beschuldigten Hennig der infamen Lüge. Andere klagten, dass ihre Anstrengungen, ein dem Teufel angemessenes Umfeld zu schaffen, noch zu gering gewesen seien. Die dritte und grösste Gruppe ging einfach frustriert nach Hause. Da die Kälte langsam in alle Glieder kroch, tat es ihr bald auch der Rest gleich. Am Ende stand Hennig ganz allein auf dem Balkon des Gemeindehauses, den Zettel mit der Begrüssungsrede zwischen den klammen Fingern. Er wollte ihn frustriert zerknüllen, als am Rande des Platzes plötzlich eine merkwürdige Gestalt mit Kapuze auftauchte. Vor dem Gemeindehaus angekommen, streifte sie die Kopfbedeckung ab, und zum Vorschein kam eine alte Frau mit einem furchtbar bösen, vernarbten Gesicht. Sie streckte ihren Finger nach Herrn Hennig aus und sagte: «Er kommt nicht, und wird nicht kommen. Er hatte einen Unfall.» Bevor Hennig etwas darauf zu erwidern wusste, machte sie kehrt und schlich wieder vom Platz. Der Gemeindepräsident blieb verwirrt auf dem Balkon stehen, selbst nachdem die Alte längst verschwunden war. Welche Art von Unfall würde den Teufel behindern? Trotz angestrengter Überlegung fand er keine Antwort darauf. Resigniert kehrte er in sein Büro zurück und warf das Schreiben fort, das, wie er erkannte, lediglich ein Folterinstrument gewesen war.