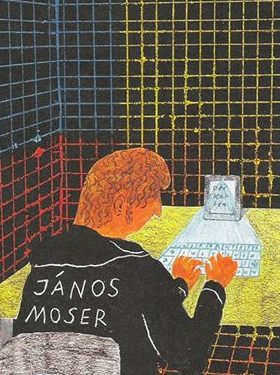Beim Abriss eines alten Hauses in der Nähe des Flusses, der durch die Hauptstadt strömte, waren Mauerreste einer mittelalterlichen Kirche entdeckt worden. Ersten Untersuchungen zufolge stammte das Bauwerk aus dem zwölften Jahrhundert. Seine Existenz gab der Kantonsarchäologie zweierlei Rätsel auf: Zum einen wurden Kirchen für gewöhnlich in Siedlungszentren und nicht in Flussnähe gebaut, zum anderen war das angrenzende Gräberfeld viel besser erhalten als der dazugehörige Kirchenbau. Wir fanden menschliche Überreste, von denen manche in so gutem Zustand waren, als seien sie erst vor wenigen Monaten zur letzten Ruhe gebettet worden. Bald gingen unheimliche Gerüchte durch das Städtchen: Der Ort sei mit einem bösen Zauber, einem Fluch belegt, der jeden Menschen ereile, der sich auf den Boden der Kirche wagte. Obwohl ich die Ausgrabungen leitete, waren mir keine Veränderungen aufgefallen, weder an mir noch an meinen Kollegen. Doch kurz, nachdem wir die Toten zur Untersuchung ins Labor transportiert hatten, geschah ein kurioser Zwischenfall: Als ich eines Morgens zur Ausgrabungsstätte kam, lag ein Mann in einer Mulde zwischen den Gräbern. Offenbar hatte er sich diese selbst erschaufelt, denn die Vertiefung war gestern noch nicht da gewesen. Verwirrt näherte ich mich dem Mann und fragte, ob alles in Ordnung sei. Dem Aussehen nach hätte er Manager oder Versicherungsangestellter sein können. Auf meine Frage reagierte er ungehalten und meinte, ich würde seine Ruhe stören. Ich wies ihn darauf hin, dass er sich auf einem Untersuchungsgelände befinde, da richtete er sich auf und meinte: «Ich weiss, welche Untersuchung. Und genau deswegen bin ich hier.»
«Das müssen Sie mir erklären», sagte ich und griff nach dem Handy, um notfalls mit der Polizei zu drohen.
«Na sehen Sie mich an», sagte er. «Ich bin so gut wie tot. Da habe ich mir gedacht, warum geselle ich mich nicht gleich zu ihnen?»
«Zu ihnen?»
«Den Toten.»
Ich verstand nicht. Also hakte ich nach: «Was meinen sie mit so gut wie tot?»
«Na, ich führe eine Schattenexistenz. Ich bin Versicherungsangestellter, lebe nur noch für die Arbeit. Jeden Tag von früh bis spät. Zeit für Hobbys und Erholung bleibt mir nicht. Das ist kein Leben, verstehen Sie?»
«Das tut mir leid», murmelte ich und wollte die Polizei rufen. Zu meiner Erleichterung löste sich das Problem von selbst. Der Mann klopfte sich die Erde von den Kleidern und schlich mit hängenden Schultern davon. Ich sah ihm nach, bis er hinter einer Ecke verschwunden war, atmete auf und wartete auf meine Kollegen, die kurz darauf eintrafen. Ich erzählte ihnen von dem Mann, aber sie schienen sich nichts daraus zu machen und hielten ihn für einen verirrten Alkoholiker. Also vertieften wir uns in die Arbeit.
Die drei folgenden Tage blieben ohne Störung. Aber am vierten Tag kehrte der Alkoholiker zurück. Und nicht nur das: er brachte drei Freunde mit. Wie er sahen sie im Grunde nicht aus wie typische Randgestalten. Der eine trug eine Postuniform, der andere die eines Servicefachmanns. Der dritte war mit Motorenöl beschmiert, wohl, weil er in einer Werkstatt arbeitete. Alle vier hatten sich kleine Mulden gegraben, in denen sie still lagen.
«Was wollen diese Leute hier?», fragte eine Mitarbeiterin, die zeitgleich mit mir bei der Ausgrabungsstätte angekommen war. Ich zuckte hilflos mit den Achseln.
Der Servicefachmann richtete sich auf und verkündete: «Hier sind wir und hier bleiben wir, um wie die Toten zu sein. Denn so fühlen wir uns.»
«Weil Sie keine Freizeit haben?», mutmasste ich.
Die vier Männer nickten.
«Warum liegen Sie dann hier, statt zu arbeiten?», bemerkte meine Mitarbeiterin.
Das war ein guter Punkt.
«Natürlich haben wir ab und zu frei», gab der Servicefachmann zu. «Aber nicht genug, um wieder an Lebenskraft zu gewinnen.»
«Durch Herumliegen kriegen sie jedenfalls keine», warf die Mitarbeiterin zynisch ein.
Der verschmierte Mann sagte: «Darum geht es ja gerade nicht. In diesen Mulden liegend, entsprechen wir unserer Existenz.»
«Denn im Tod sind wir eins mit uns selbst», ergänzte der Pöstler.
«Aber Sie sind doch nicht tot», warf die Mitarbeiterin ihnen genervt entgegen.
Die Männer widersprachen heftig.
Ich seufzte. «Das bringt wohl nichts.»
Sie wandte sich zu mir um. «Und was tun wir jetzt?», fragte sie aufgebracht. «Wenn die hier liegen bleiben, können wir nicht arbeiten.»
«Ich wollte eigentlich die Polizei rufen …», murmelte ich und fuhr mit der Hand in die Hosentasche. – Doch das war nicht nötig, denn wir wurden durch einen unwahrscheinlichen Zufall – oder war es eine logische Konsequenz? – gerettet.
Auf dem Gelände tauchten nämlich die Toten auf, und zwar diejenigen, die wir zur Untersuchung ins Labor geschickt hatten. Ihr Kommen wurde durch entsetzte Schreie von Passanten angekündigt, und sich selbst kündigten sich durch schauerliche Stöhnlaute an. Der Anblick, den sie boten, war grässlich: Sie waren nichts als Haut und Knochen, grinsende Schädel mit leeren Augenhöhlen, in denen Maden hausten. Das war auch den vermeintlich toten Männern zu viel – Hals über Kopf, wie von Sinnen schreiend, suchten sie das Weite. Die Mitarbeiterin und ich schauten derweil perplex zu, wie sich die wandelnden Leichen in ihre Gräber legten und damit ihre ursprünglichen Plätze wieder einnahmen. Daraufhin herrschte Stille; so plötzlich, wie sie auferstanden waren, hatten sie sich wieder in leblose Überreste verwandelt.
«Was tun wir jetzt?», fragte ich die Mitarbeiterin unsicher.
«Arbeiten wir weiter?», fragte sie aufmunternd zurück.
Die Untoten
Kategorie: Literatur